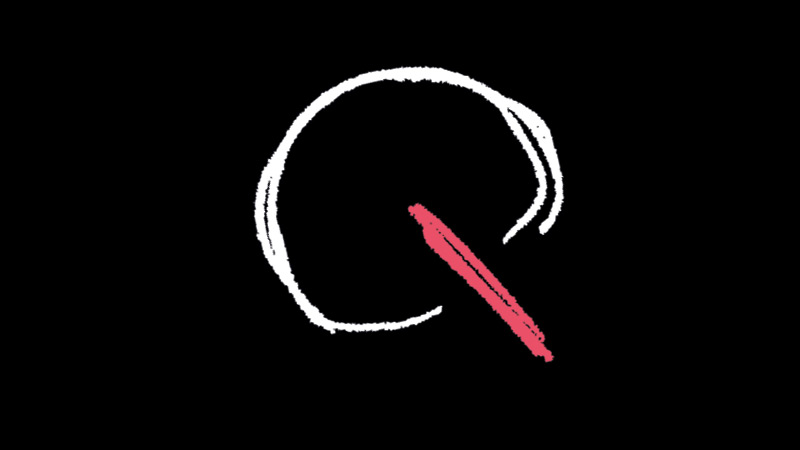Byung-Chul Han beschäftigt sich in seinem Buch »Die Errettung des Schönen« erneut mit der Frage nach der Zeitlichkeit und seiner narrativen Strukturen gegenüber punktueller Abfolgen von Ereignissen.
Für ihn sind Informationen eine reine Addition, die nichts erzählen und die Narration verdrängen.1 Wissen besitzt dagegen eine Innerlichkeit und verbindet durch eine andere Zeitstruktur die Vergangenheit mit der Zukunft.2 Informationen weisen jede Metapher von sich, sind transparent und sprechen geradeaus, während sich das Wissen geheimnisvoll zurückziehen kann.3 Des Weiteren lassen sich laut ihm zwar Informationen aus dem »Daten-Haufen« herausfiltern, »sie generieren jedoch weder Erkenntnis noch Wahrheit.«4 Zusätzlich wohnt der Wahrheit »eine Vertikalität inne. Daten und Informationen bewohnen dagegen das Horizontale.«5
Narration trotz Informationen
In meinem Beitrag »Das globale Dorf – Raum, Zeit und Dynamik« beschreibe ich meine Überlegungen, eine Narration zu erstellen, die letztendlich durch Daten – und damit Informationen – dynamisch veränderbar ist. An dieser Stelle komme ich in den Zwiespalt, ob das tatsächlich eine Erzählung sein kann, der die grundlegende Eigenschaft von Dauer innewohnen kann, über die Han auch schon in anderen Büchern schreibt. Aus meiner Sicht könnte es dem Anspruch einer Narration gerecht werden, wenn die eigentliche Erzählung von Menschenhand – damit durch Wissen und nicht durch reine Information – entwickelt ist und lediglich die Bildwelt mit genau festgelegten Kriterien durch Information erschaffen wird. Generell müsste man diesem Ansatz jedoch als Experiment sehen, da es durchaus sein kann, dass die Bildwelt trotz exakter Kriterien eher additiv und zufällig entsteht und die eigentliche Erzählung nicht transportiert wird. Andererseits wäre hier Raum für unvorhersehbare Zufälligkeiten, die ihr einen neuen Reiz zusprechen könnte.
Mit Loops zum Moment der Dauer
Han führt zudem aus, dass kinematographische Bilder im Gegensatz zu Photogrammen aufgrund ihrer Zeitlichkeit kein punctum besitzen. »Die Sprache des punctum ist ein Traumprotokoll der Imagination« und man kann die Augen nicht schließen, weil beim Öffnen ein anderes Bild zu sehen ist. Man ist zu ständiger Gefräßigkeit gezwungen und vor allem die Nachdenklichkeit würde hier auf der Strecke bleiben.6 Hier stelle ich mir die Frage, ob meine Idee, Erzählungen mit Loops zu schaffen (Von Loops und der Hyper-Realität »), dieses Problem lösen kann. Man hätte immer wieder auf ein Neues Zeit, in sich zu gehen und die Loops auf sich wirken zu lassen. Zusätzlich gäbe es keinen konkreten Anfang und kein konkretes Ende, was grundsätzlich einen Moment der Dauer hervorrufen könnte. Mit dieser Fragestellung möchte ich mich weiterhin beschäftigen, da ich momentan davon überzeugt bin, dass es eine Lösung geben könnte, die beide Welten von Information und Wissen vereint.
Quellen
- Vgl. Han, Byung-Chul: »Die Errettung des Schönen«, Frankfurt am Main 2015, 3. Auflage, S. 90.
- Vgl. Ebd., S. 19.
- Vgl. Ebd., S. 42.
- Ebd., S. 71.
- Ebd.
- Vgl. Ebd., S. 49.